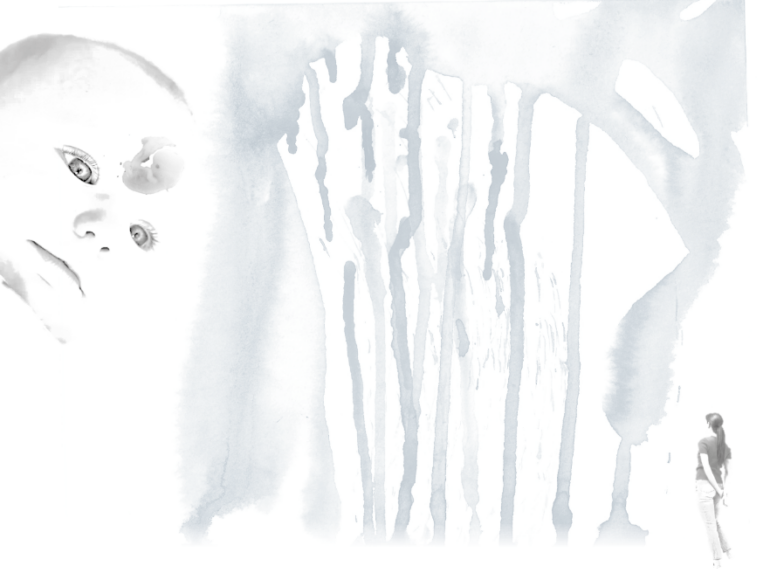
Es beginnt schon bei der Selbstbezeichnung: «Pro-Life» nennt sich die US-amerikanische Abtreibungsgegnerschaft. Auch in der Schweiz gibt es verschiedene Organisationen, die sich gegen Schwangerschaftsabbrüche engagieren, mit gleichen oder ähnlich schönen Namen. Man möchte nicht unbedingt als Abtreibungsgegner*innen bezeichnet werden, sagt Robert Hafenrichter, Abtreibungsgegner und Präsident des Vereins für Schutz von Mutter und Kind, in einem Beitrag von Nau; nicht gegen die Abtreibung, sondern für das Recht des ungeborenen Leben würden sie schliesslich einstehen, das klinge ansonsten sehr negativ.
Menschenrechte, die Sprache der Linken
Diese Verkehrung der Tatsachen ist ein Merkmal der Anti-Abtreibungsbewegungen seit Beginn der 1970er Jahre. Angesichts der Erfolge der Bürgerrechts- und feministischen Bewegungen der USA konnten konservative Bewegungen nicht mehr im gleichen Stil über ihre politischen Absichten sprechen. Die Historikerin Jennifer L. Holland spricht deshalb nach den 1970ern von einer neo-konservativen Bewegung, zu der sie auch die Abtreibungsgegner*innenschaft zählt. Neu waren die Ausdrucksformen und die vermeintlichen Absichten. Es ging von nun an um Menschenrechte, ja um den Schutz von Hilfsbedürftigen. Sprechen Abtreibungsgegner*innen also über Schwangerschaftsabbrüche, so geht es selten um die Schwangeren, im Zentrum steht vielmehr der vermeintliche Schutz des Fötus. Oftmals ist die Rede von einem Genozid an Ungeborenen. Föten sind in der Logik der Abtreibungsgegner*innen die schützenswertesten Lebewesen, weil sie sich nicht selbst verteidigen können.
Schutz von Ungeborenen und Schwangeren,
die Sprache der Retter*innen
Die Abtreibungsgegnerschaft übernimmt dabei gezielt die Sprache und Argumente von progressiven linken Bewegungen, die sich seit den 1970er Jahren für die Rechte von marginalisierten Gruppen einsetzen. In einer Aufzeichnungen des «Marsch fürs Leben» in den USA von 1990 – ein Protestmarsch von Abtreibungsgegner*innen der jährlich in mehreren Ländern stattfindet – nehmen die Redner direkt Bezug auf Martin Luther King, setzen die eigene Bewegung gleich mit dem Kampf gegen Sklaverei und Apartheid. Mit solchen Anmassungen verdeckt die Abtreibungsgegner*innenschaft die Tatsache, dass die körperliche Selbstbestimmung mit einem Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen massiv beschnitten wird.
Geht es innerhalb der Abtreibungsgegner*innenschaft doch einmal um ungewollt schwangere Frauen, wird Abtreibung als Bedrohung für Psyche und Körper dargestellt. Gerade kürzlich sorgten Plakate in Basel für Kritik. «Schwanger und in Sorge?», so der Slogan. Die Plakate bewarben Hilfe für Schwangere und verwiesen auf eine Hotline der Schweizerischen Hilfe für Mutter und Kind, eine Organisation, die sich gegen Schwangerschaftsabbrüche stellt und Schwangeren durch Beratungen von einem Schwangerschaftsabbruch abrät. Auf der Webseite der Organisation werden mögliche Gefahren eines Schwangerschaftsabbruchs heraufbeschworen, sie reichen von «funktionalen Sexualstörungen», über Unfruchtbarkeit, zu Selbstmordgedanken.
Ethik und Bioethik,
die neutrale Sprache der Philosophie
Die hiesige Abtreibungsgegner*innenschaft zeigt sich jährlich am «Marsch fürs Läbe». «Marsch fürs Läbe» Schweiz ist vernetzt mit vielen anderen Gruppierungen, die sich für dasselbe einsetzen, auch über die Landesgrenzen hinaus. So bewirbt «Marsch fürs Läbe» sogenannte Ethikkurse für Medizinstudent*innen, ausgehend vom Institut für medizinische Anthropologie und Bioethik in Österreich (IMABE). Studierende der Medizin sollen in speziellen Ethikseminaren lernen, Entscheidungen zu treffen, die sie ethisch herausfordern und in «ihrer ethischen Kompetenz gestärkt werden». In jeder Sitzung soll ein neuer «ethischer Konflikt» betrachtet werden: Sterbehilfe, operative oder hormonelle Transitionen bei trans Personen sowie Schwangerschaftsabbrüche. Die Titel der jeweiligen Sitzungen lauten «Transgender Medizin und psychische Verantwortung» oder «Patientengespräche und die Rolle des Vertrauens». Bei den aufgeführten Expert*innen der Ethikkurse handelt es sich um medizinische Fachpersonen, die zugleich Abtreibungsgegner*innen, Gegner der Sterbehilfe sowie Gegner*innen von operativen Transitionen sind.
Im Namen der Ethik wird hier Einfluss auf junge Menschen im Medizinbereich genommen, das Programm solcher Seminare könnte dabei auch wie folgt lauten: Für weniger körperliche Selbstbestimmung auf allen Ebenen.
Alles ist Biologie, die Sprache der Wissenschaft
Neben vermeintlich ethischen und progressiven Argumenten greift die Abtreibungsgegner*innen schaft auch immer wieder auf die Biologie zurück. Aktivist*innen, die sich nach US-Amerikanischem Vorbild auch in Basel oder kürzlich in Wil vor Kliniken versammelten, um dort gemeinsam zu beten, verweisen dabei gerne auf die biologische Entwicklung des Fötus. Herzschläge, Chromosomen, Hirnströme werden als Beweis angeführt. Der Fötus wird als eigenständiges Lebewesen dargestellt, unabhängig vom schwangeren Körper.
Diese Art der Argumentation eignet sich besonders gut, weil sie visuell viel hergibt. Der bereits entwickelte Mensch lässt sich bildlich gut darstellen. Abtreibungsgegner*innen nutzen gerne Darstellungen von Föten auf Plakaten oder Webseiten, die aussehen wie komplett entwickelte Lebewesen, wie winzige Babys. Das warst einmal du, suggerieren die Bilder, man könnte sich auch gegen dich entschieden haben, und schaffen damit einen persönlichen Bezug zum Thema.
Zielgruppe und Ideal
Werbeaktionen wie die genannten Plakate für ungewollt Schwangere oder auch der aktuelle Werbefilm von «Marsch fürs Läbä» richten sich oftmals an alleinstehende Frauen, die schwanger sind. Sie sind – nebst politischen Bestrebungen, wie die 2022 gescheiterten Initiativen zur Einschränkung von Schwangerschaftsabbrüchen – das Zielpublikum der Abtreibungsgegner*innenschaft. Was nicht darüber hinwegtäuschen soll, dass Abtreibungsgegner*innen ein klares Ideal verfolgen: Die heteronorme kinderreiche Familie. Das zeigt sich etwa am Verein Pro-Life Schweiz. Der Verein bietet, basierend auf einem Vertrag mit der Krankenkasse Helsana, seinen Mitgliedern Vergünstigungen bei Ergänzungsleistungen der Krankenkasse. Das Angebot richtet sich speziell an Familien: Bei Familien mit mehr als vier Kindern übernimmt der Verein die Grundversicherung jedes weiteren Kindes, für jedes Kind erhält die Familie ausserdem 400.-. Einzige Bedingung: Es muss eine Verzichtserklärung auf Schwangerschaftsabbrüche unterzeichnet werden. Die Verhinderung von Schwangerschaftsabbrüchen und die Förderung kinderreicher Familien gehen dabei Hand in Hand.
Ein Angriff auf den Körper
Nicht umsonst lautet einer der feministischen Leitsprüche: «My body, my choice». Der Satz umfasst verschiedene Aspekte: Das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche, auf Hormontherapien oder geschlechtsangleichende Operationen, das Recht darauf, über die eigene Kleidung bestimmen zu können. Das Recht also auf körperliche Selbstbestimmung. Wie die queerfeministischen Befreiungsbewegungen zielen auch antifeministische Bewegungen auf den Körper der Betroffenen ab. Die Abtreibungsgegner*innen schaft ist dafür ein Beispiel par excellence. Ihre Argumentationen mögen sich über die Zeit gewandelt haben, und werden sich wohl wieder ändern, in Zeiten, in denen Unsagbares wieder sagbar wird. Aber in ihren Absichten bleibt sich die Abtreibungsgegnerschaft treu: Es geht um nicht weniger als um die staatliche Regulierung der Körper von Frauen.
