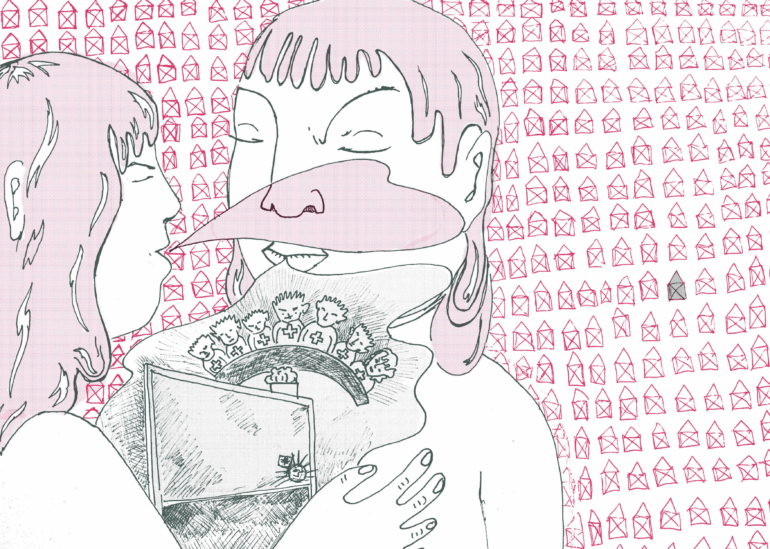
Meine Mama und ich stehen in der Küche und backen Kuchen, wie früher. Damals in Belp, heute in Bolligen. Seit diesem Jahr sind wir zwanzig Jahre in der Schweiz und noch nie haben meine Mutter und ich über die Bedeutung von Heimat gesprochen. Über ihre Beweggründe, Tunesien zu verlassen und darüber, wie es sich für sie anfühlt, hier zu sein.
Meine Eltern kommen aus Tunesien. Mit achtzehn Jahren sind sie mit einem Stipendium nach Deutschland gereist, um zu studieren. Als sie siebenundzwanzig Jahre alt waren, bin ich in München geboren. Zwei Monate später sind sie mit mir zurück nach Tunis. Mein Vater hat bei Siemens gearbeitet, meine Mutter bei der tunesischen Luftfahrtbehörde. Als ich vier Jahre alt war, sind wir nach Wabern gezogen. Aufgewachsen bin ich in Belp und Ittigen. 2004 kam mein kleiner Bruder auf die Welt. Er hat seine Kindheit auf einem Bauernhof in Ittigen verbracht. Vor sieben Jahren wurden wir als Familie eingebürgert – ich war siebzehn, mein Bruder acht Jahre alt.
Dasein, nicht von da sein
Es heisst, Politik sei die Frage, wie man als Gesellschaft zusammenleben will. Politik in der Schweiz heisst für mich, dass per Volksinitiative die Frage gestellt wird, ob sie mit mir zusammenleben wollen. Diesen Sommer las ich das Buch «Sprache und Sein» von Kübra Gümüşay und verfolgte parallel dazu die Debatte um die Begrenzungsinitiative. Ich begann mich im Bus unwohl zu fühlen, fragte mich, ob die anderen Menschen denken, dass ich ihnen ihren Platz wegnehme. Ich fragte mich, ob sie in mir den Grund sehen, warum es Stau gibt. Ich fragte mich ob sie denken, dass ich ihnen ihren Job wegnehme und ihr Quartier unsicher mache. In solchen Momenten fühle ich mich sehr einsam. Ich gehöre zu den Menschen, die zwischen zwei Welten hin und her geschoben werden. Die eine Welt ist uns fremd, weil wir sie nicht kennen, weil wir ihre Sprache nicht einwandfrei beherrschen und vor allem weil wir in ihr nie gelebt haben. In der anderen Welt sind wir fremd, weil wir anders aussehen, einen anderen Namen tragen, eine andere Sprache sprechen, eine andere Religion ausüben. Die Frage nach meiner Herkunft ist eine Frage nach meiner Identität, die ich nicht durch Benennen beantworten kann.
«Du und ich, Mama, wir sind Benannte. Du bist immer zu allererst Frau und Ausländerin. Wenn du bei der Arbeit bist, bist du nicht Ingenieurin wie alle anderen, sondern eine weibliche Ingenieurin und eine ausländische Ingenieurin.»
«Du hast recht, aber in Tunesien wurde ich genauso benannt. Dort war ich immer nur Frau. Als wir nach unserem Studium in Deutschland zurückkamen und ich in Tunis gearbeitet habe, wurde ich nicht respektiert. Ich wurde jeden Tag belästigt. Irgendwie habe ich es immer geschafft schwierigen Situationen zu entkommen. Aber ich habe es nicht ausgehalten. Ich konnte mich nicht wehren, weil es meine Vorgesetzten waren und ich diese Stelle brauchte. Dein Vater und ich, wir hatten nicht genügend Geld um mit nur einem Einkommen auszukommen.»
«War es aber auch so, dass du dich nicht gewehrt hast, weil du es gar nicht als unrecht angesehen hast?»
«Natürlich. Ich dachte: Ich bin eine Frau. Es ist normal, dass diese Sachen passieren, es gehört dazu.»
«Da liegt doch das Problem: Wir haben nie gelernt uns zu wehren. Wir nehmen diese Position an, weil wir erst lernen müssen, dass es nicht normal ist, belästigt zu werden und immer Angst vor Gewalt haben zu müssen. Die Benennenden sind immer Andere, aber wir bleiben die Benannten.»
«Deshalb wollte ich Tunesien verlassen. Manchmal habe ich ein schlechtes Gewissen, dass wir dich hierhergebracht haben. Es war meine Entscheidung hierher zu kommen und ich wusste genau, was ich tue. Wir haben in Deutschland Diskriminierung erlebt und uns deshalb auch entschieden zurück nach Tunesien zu gehen. Als wir in die Schweiz zogen, wusste ich genau, was auf dich zukommen wird.»
«Ich war lange wütend auf euch, weil ihr mit mir in die Schweiz gekommen seid. Ich hatte keine schöne Kindheit hier. Ich habe mich immer ausgeschlossen und nicht zugehörig gefühlt. Wenn wir in Tunesien waren, war ich glücklich. Ich hatte eine Familie und Freund*innen. Ich war erwünscht. In der Schweiz hatte ich dieses Gefühl nicht. Es war schlimm für mich, als ich eines Sommers gemerkt habe, dass ich auch in Tunesien nicht dazugehöre. Dass ich andere Interessen habe, ein anderes Leben führe und eine andere Sprache spreche.»
«Du gehörst nicht dazu, du gehörst nirgends dazu. Weder hier noch in Tunesien. Ich auch nicht. Wir waren letzte Woche nach der Arbeit ein Bier trinken. Ich konnte nicht mitreden über Berge und Wanderrouten. Aber wenn ich in Tunesien bin und mit meiner Schwester und ihren Freundinnen bin, fühle ich mich auch nicht zugehörig. Du hast mich letzte Woche gefragt, wie ich mich in den Sprachen fühle. Ich fühle mich in keiner der Sprachen zugehörig.»
«Es wurde mir lange verwehrt, mich hier zu Hause fühlen zu dürfen. Mein Platz war irgendwo anders, hier war ich nur zu Besuch. Aber ich habe sonst nichts. Ich habe keine Heimat. Deshalb antworte ich auf die Frage, was meine Heimat ist immer, dass du und Papa meine Heimat seid. Ich habe keine andere. Wir sprechen eine eigene Sprache, die nur wir so sprechen. Ich bin nicht Schweizerin und auch nicht Tunesierin. Die einzige Heimat, die ich kenne, seid ihr.»
«Weisst du noch die Einbürgerung?»
«Ich habe mich so gewehrt.»
«Du wolltest es nicht verstehen. Du konntest es auch nicht verstehen. Du hast es erst verstanden, als du zwei Jahre später mit deiner besten Freundin reisen warst und du gesehen hast, was es bedeutet, den falschen Pass zu haben. Du bist zurückgekommen und hast dich entschuldigt.»
«Bis heute widerstrebt mir der Gedanke an die Einbürgerung. Ich weiss es noch so genau. Ich musste da hin und diesen Menschen erklären, warum ich es verdient habe hier zu sein, und ich musste ein Land lobpreisen, das mich nie anerkannt hat. Ich bin damit aufgewachsen, dass ich hier nicht erwünscht bin, dass ich anders bin und dass ich nicht dazugehöre. Es war so erniedrigend, mich vor diese sieben Menschen zu setzten und sie quasi anzubetteln, mich als ihresgleichen anzuerkennen. Aber für euch war es noch viel schlimmer.»
«Weisst du, wie erniedrigend es für uns war, in diese Kurse zu gehen und diese Prüfung zu schreiben? Wir haben ein deutsches Sprachdiplom. Wir haben ein Ingenieursdiplom. Wir haben vierzehn Jahre in diesem Land gelebt und gearbeitet.»
«Das schmerzt mich am meisten. Die Erniedrigungen, die ihr hier erleidet. Jedes Mal, wenn Menschen euch auf Hochdeutsch antworten oder das Wort an mich richten, weil sie denken, ihr versteht sie nicht.»
«Fühlst du dich hier zu Hause?»
«Ich musste erst gehen, um zu merken, dass Bern mein zu Hause ist. Als ich vor drei Jahren von meinem Austauschjahr zurückgekommen bin, hatte ich das erste Mal das Gefühl, nach Hause zu kommen. Ich habe mich nicht mehr fremd gefühlt. Dieses Gefühl wird mir mit jeder neuen Initiative, bei der gefragt wird wer nun dazugehören darf und wer nicht, wieder genommen. Mit jeder neuen Initiative wird mir vor Augen geführt, dass ich hier fremd bleibe, auch wenn ich mich nicht fremd fühle.»
«Sie werden uns nie als ihresgleichen anerkennen. Letztens meinte mein Chef, mein Fachwissen sei viel zu fundiert. Ich überfordere meine Mitarbeiter*innen, sagte er. Ich habe lange darüber nachgedacht, warum es mir so wichtig ist, dieses Fachwissen so zu beherrschen. Die Antwort ist, dass es das einzige ist, was ich tun kann, das einzige was in meiner Hand liegt. Ich kann kein Mann sein. Ich kann keine Schweizerin sein. Das Einzige, was ich kann, ist fachlich gut genug sein.»
Nach diesem Gespräch konnte ich an nichts anderes denken. Ich konnte nachts nicht schlafen und mich tagsüber nicht konzentrieren. Ich will über Gefühle sprechen. Über das Gefühl, als siebzehnjähriges Mädchen vor sieben erwachsenen Menschen zu sitzen und ihnen zu erklären, warum ich es verdient habe als ihresgleichen anerkannt zu werden. Zu begründen und zu argumentieren, warum ich gerne hierbleiben möchte, am einzigen Ort, den ich kenne. Ein Land zu lobpreisen, welches mir immer die Zugehörigkeit verwehrt hat. Und das im selben Jahr, in dem die Masseneinwanderungsinitiative angenommen wurde.
Begrenzen heisst Ausgrenzen
Mit jeder fremdenfeindlichen Initiative und ihrer medialen Aufbereitung wird mir dieses Gefühl, nicht fremd zu sein, wieder genommen. Ich weiss, dass meine Freund*innen meine Existenz nicht hinterfragen, aber was ist mit den hunderttausenden von Menschen, die diese Initiativen unterschreiben? Was ist mit den 1 463 854 Menschen, die Ja stimmten zur Masseneinwanderungsinitiative? Gibt es für Menschen wie mich einen Ort an dem wir erwünscht sind, wo wir unsere Existenz nicht erklären müssen? Einen Ort an dem wir uns nicht alle Jahre wieder als Feindbilder konstruiert sehen?
Es geht nicht darum, ob die Initiativen angenommen werden oder nicht. In der Zeitung zu lesen, dass es Menschen gibt, die mich hier nicht wollen, tut weh. Durch die Stadt zu fahren, die mein Zuhause sein sollte und Plakate zu sehen, die mir genau das absprechen, tut weh. Erklären zu müssen, warum «Afrikaner*innen» nicht faul sind, tut weh. Zu wissen, dass meine beste Freundin bald durch dasselbe erniedrigende Einbürgerungsverfahren muss, tut weh. Dass mein Bruder regelmässig von der Polizei kontrolliert wird, weil er so aussieht, wie er aussieht, tut weh. Ein Video zu sehen, in dem Menschen wie ich, meine Eltern, mein Bruder und meine besten Freund*innen als Feindbilder konstruiert werden, tut weh.
Wenn für politische Zwecke die Bevölkerung in Ausländer*innen und Schweizer*innen zweigeteilt wird, verwehrt das einem Drittel der Menschen die Zugehörigkeit. Und es ist egal, ob diese Personen hier geboren wurden, seit fünfzig Jahren hier leben, oder erst vor einer Woche hierhergezogen sind. Wir alle verdienen es, mit Respekt behandelt zu werden. Es ist unser aller Recht, als Menschen wahrgenommen zu werden.
Ich kann kein Mann sein. Ich kann auch keine Schweizerin sein. Ich kann nicht ändern, wer ich bin und ich will auch nicht ändern wer ich bin. Ist es absurd mir trotzdem zu wünschen, als euresgleichen anerkannt zu werden?
